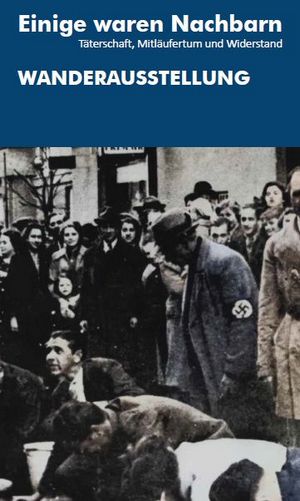Weinliebhaber und Architekt der Turnhalle
Wer war Siegfried Monat?
Vorbemerkung: Die Vereinszeitschrift des Turnvereins 1848 in Guntersblum veröffentlicht im März 2025 einen von der Stolpersteingruppe, anlässlich des 175. Vereinsjubiläums, verfassten Artikel über Siegfried Monat, den Erbauer der ehemaligen Turnhalle, des heutigen Dorfgemeinschaftshauses.
Der Erbauer der Guntersblumer Turnhalle – dem heutigen Dorfgemeinschaftshaus – liebte den rheinhessischen Wein. So sehr, dass Siegfried Monat 1925 sogar ein Gedicht darüber schrieb: „Dem rheinhessischen Wein / Kein anderer Tropfen gleicht / Beschwert nicht die Beine / Und macht die Herzen leicht“. Sein Vater David, der ein Textilgeschäft in der Mittelstraße führte, baute als Nebenerwerbswinzer selbst Wein an. Und er liebte offenbar Sport: zumindest war Siegfried Monat Mitglied im Turnverein. Als dieser im Jahr 1929 den Neubau einer eigenen Turnhalle in Auftrag gab, bekam Siegfried Monat den Zuschlag: im November lobte die Lokalpresse: „Guntersblum hat endlich seine Turnhalle und kann stolz darauf sein“. Zum Guntersblumer Markt öffnete sie zum ersten Mal ihre Tore: „Unsere Turnerinnen und Turner haben jetzt ein Heim, in dem sie ungestört jederzeit ihre Übungen abhalten können.“ Doch die Geschichte hatte eine Schattenseite: da die Baukosten wegen der Inflation weit über den veranschlagten Ausgaben lagen, ging das Gebäude am Ende in das Eigentum der Ortsgemeinde über. Der Turnverein konnte dem Erbauer seiner Halle das Honorar nicht zahlen: Siegfried Monat erhielt für das Projekt kein Geld.
Dass Siegfried Monat nicht nur Weinliebhaber, Sportler, TV-Mitglied und Turnhallenarchitekt, sondern auch Jude ist, ändert kurze Zeit später für ihn und seine Familie alles. 1933 treten die Nationalsozialisten ihre Macht an; auch in Guntersblum. Am 13. Mai 1933, nur wenige Wochen nach einer regulären Vorstandswahl, bei der das jüdische Vereinsmitglied Emil Rüb noch im Wirtschaftsausschuss bestätigt worden war, findet auf Anweisung der Deutschen Turnerschaft in Folge eines Beschlusses vom 08.04.1933 eine außerordentliche Hauptversammlung statt: es wird nicht nur das Horst-Wessel-Lied gesungen (die Parteihymne der NSDAP), sondern auch ein neuer Mann an der Spitze bestimmt: anstatt des bisherigen 1. Vereinsvorsitzenden gibt es jetzt einen „Vereinsführer“. Dieser ernennt die Mitglieder seines Vorstandes und hat an seiner Seite einen „Dietwart“ – der dafür sorgt, dass der Verein im nationalsozialistischen Sinne geführt wird. Alle Veranstaltungen enden von nun an „mit einem Sieg Heil auf unseren Führer“.
Siegfried Monat muss klar geworden sein, dass er in diesem Deutschland keine Zukunft haben würde. Im Juni 1933 verlässt er Deutschland – alleine, mit einem Koffer und etwa 160 Reichsmark, über Frankreich nach Brasilien. Mit Hilfe eines Darlehens von einer jüdischen Wohlfahrtsorganisation in Rio de Janeiro gelingt es ihm im April 1934, seine Frau Hedwig und die Kinder Ludwig und Else nachzuholen. Die Rettung seiner Eltern scheitert: Siegfrieds Mutter Johanna stirbt 1941 in einem Krankenhaus in Mainz. Sein Vater, David Monat, wird im Mai 1942 deportiert: ein Guntersblumer SA-Mitglied ist beteiligt, als er gemeinsam mit zwei weiteren Juden gezwungen wird, einen geschlossenen Lieferwagen zu besteigen. Am 27.12.1942 wird David Monat im Ghetto Theresienstadt ermordet – er ist 78 Jahre alt. Heute erinnert vor seinem ehemaligen Geschäft in der Mittelstraße an ihn ein Stolperstein.
Als David Monat stirbt, ist der Guntersblumer Turnverein schon lange „gleichgeschaltet“ und heißt seit 1938 „Sportgemeinde Guntersblum“. Jüdische Mitglieder gibt es nicht mehr. Sieben der insgesamt 155 Mitglieder, die der Turnverein Ende 1932 zählt, waren jüdischen Glaubens – sie alle verlieren im Laufe des Jahres 1933 ihre Mitgliedschaft. Im November 1935 nimmt der Verein den „Arier-Paragraphen“ in seine Satzung auf.
Arthur Mayer, 1925 Mitglied im Finanzausschuss, mag im April 1933, als er verhaftet und ins das KZ-Osthofen gebracht wurde, zwei seiner Turnbrüder begegnet sein: sie waren dort als SA-Mitglieder freiwillig in der Wachmannschaft tätig.
Im Nationalsozialismus waren aus Vereinsbrüdern Täter und Opfer geworden. Das 77. Vereins-jubiläum, 1925 festlich begangen, hatten sie noch gemeinsam organisiert: Lehrer Stein von der Jüdischen Schule saß zusammen mit dem ev. Pfarrer Ludwig von der Au im Ehrenausschuss – ein Beispiel friedlicher Koexistenz der Religionen. Den Empfangs- und Quartiersausschuss bildeten der Jude Lothar Erlanger, der mit seinem Geschäft in der Hauptstraße 37 den Turnverein regelmäßig belieferte, zusammen mit weiteren Turnbrüdern: besonders einer dieser Ausschussmitglieder spielte später eine führende Rolle beim „Schandmarsch“ zur Reichspogromnacht 1938, als sechs jüdische Männer durch das Dorf getrieben, verprügelt, und ihre Häuser verwüstet und ausgeplündert wurden.
Warum also ist es wichtig, am 175. Geburtstag des Turnvereins daran zu erinnern, dass der Architekt der Guntersblumer Turnhalle ein Jude war? Seine Nachkommen leben heute in Brasilien, Schweden und der Schweiz. Welchen Platz hat ihr Vorfahr David Monat, der mit fast 80 Jahren im Ghetto Theresienstadt umkam, in ihren Herzen? Welche Rolle spielt für sie sein Schicksal? Indem wir hier und heute daran erinnern, versuchen wir ihm und all den anderen Opfern ihre Würde zurückzu- geben. Indem wir die Geschichte von Siegfried Monat als dem Erbauer unseres heutigen Dorfgemeinschaftshauses auch als unsere Geschichte erzählen, machen wir klar: der Nationalsozialismus war keine „dunkle Wolke“, die über Deutschland schwebte. Er lebte vom Mitmachen, auch in Guntersblum. Dessen sind wir uns bewusst. Gerade weil sich die Frage, wie aus Vereinsbrüdern und Freunden Täter und Opfer wurden, bis heute nicht beantworten lässt, müssen wir sie uns immer wieder stellen.
Die Stolpersteingruppe Guntersblum
Quellen: Archiv Turnverein 1848 Guntersblum (Festschriften, Bauunterlagen, Kassenbücher, Mitgliederlisten), LAS J 76/31, LAS J 76/ 33, „Kommunale Ereignisse in Guntersblum“, Selbstverlag 2. Auflage 2021 und Archiv Volker Sonneck, „Ein ganz normales Pogrom“, Sven Felix Kellerhoff, ISBN 978-3-608-98104-9